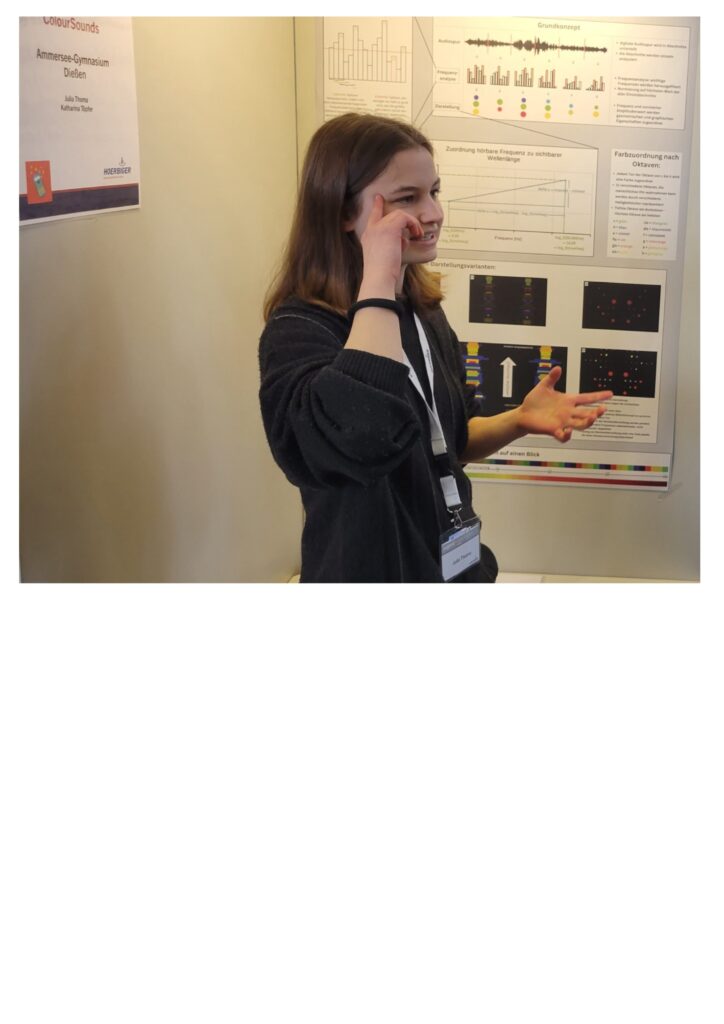Erster Preis beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ in Schongau
Satte Klänge dringen aus den Boxen, angesteuert vom Bändchenmikrofon, das Julia Thoma und Katharina Töpfer (beide Q12) selbst gebaut und eingehend untersucht haben. Beim Jugend-forscht-Wettbewerb traten sie Ende Februar in Schongau zusammen mit 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an. Die Jury verlieh den Schülerinnen vom ASG den ersten Preis in der Kategorie Technik und führte in der Laudatio aus, dass Julia und Katharina durch ihre Akribie und Fachkompetenz überzeugten, mit der die beiden ihr selbst gebautes Mikrofon untersuchten.
„Uns hat das Thema Induktion in der 10. Klasse fasziniert und daher haben wir unser eigenes Mikofon gebaut,“ berichtet Julia und erläutert das physikalische Prinzip: Schallwellen schütteln eine extrem leichte, geriffelte Aluminiumfolie zwischen zwei starken Neodym-Magneten, wodurch eine winzige Spannung induziert wird, so klein, dass sie von einem Trafo und einem Verstärker vergrößert werden muss. „Das Alubändchen haben wir selbst mir Hilfe einer Tubenpresse geriffelt, und so schlapp aufgespannt, das es nicht freudig mit einem Ton mitschwingen kann – ein solcher Ton würde sonst extrem stark herausstechen.“ Die Halterung ist aus Plexiglas gefeilt und verhindert, dass die beiden Magnete zusammenschnappen und das Bändchen zerquetschen. „Dieses Mikrofon zeichnet sich dadurch aus, dass es stärker auf tiefe Töne reagiert,“ berichtet Katharina: „Dadurch entsteht der satte Sound des Mikros“.
In langen Messreihen haben die beiden Schülerinnen die Empfindlichkeit ihres Mikros für 15 verschiedene Töne, verteilt über sieben Oktaven, genauestens untersucht indem sie den Output des Mikros mit dem gemessenen Lautstärkepegel korrelierten, und fanden heraus: Sobald eine gewisse Mindestlautstärke überschritten ist, reagiert das Mikro linear auf jede Lautstärkepegeländerung – und erfüllt damit eine wichtige Bedingung für verzerrungsfreie Tonaufnahmen. Sorgfältig eliminierten die Jungforscherinnen Störeinflüsse, indem sie die den ganzen Aufbau in einen schallisolierten Raum stellten, der innen mit schallschluckenden Schwerschaummatten ausgekleidet war. Bei allem Aufwand bewahrte das Experiment Geheimnisse, welche Katharina und Julia noch aufklären wollen: „Einige Tonhöhen nahm unser Mikro ungewöhnlich gut auf,“ so Katharina. „Ein Grund könnten stehende Wellen sein, die sich trotz Schwerschaum zwischen den Wänden des schallisolierten Raums bilden“.
Entwicklung des Programms ColorSounds
Begeistert von ihren Untersuchungen zu Schall setzten sich die zwei Schülerinnen das Ziel, Musik auf einem Bildschirm sichtbar zu machen und reichten eine zweite Arbeit im Bereich Mathematik und Informatik beim Jugend-forscht-Wettbewerb ein. „Jede Musik besteht aus Tönen, jeden Ton kann man durch seine Tonhöhe und seine Lautstärke charakterisieren“, erklärt Katharina. „Wir zerlegen Lieder in ihre Töne und analysieren sie mithilfe einer Fast-Fourier-Transformation.“ Dann wird jeder Ton durch einen farbigen Kreis auf dem Bildschirm dargestellt. Die Tonhöhe bestimmt dabei die Regenbogenfarbe, von violett für tiefe Töne bis rot für hohe Töne. Je lauter der Ton, desto größer wird der Kreis auf dem Bildschirm dargestellt, und wenn zwei Töne gleichzeitig erklingen, werden zwei Kreise nebeneinander gezeichnet. Mit der Zeit laufen diese Kreise nach oben über den Bildschirm. „Es hat uns einige Anstrengung gekostet, die Kreise synchron zu den Tönen des Liedes zu zeichnen, sodass bei jedem neuen Ton des Liedes ein neuer Kreis erscheint und man den Klang des Songs optisch verfolgen kann“, so Julia.
Außerdem fügten die beiden Schülerinnen der 12. Jahrgangsstufe ihrer App „ColorSounds“ eine zweite Reihe mit Kreisen für den rechten und den linken Kanal des Songs hinzu, erweiterten ihrer Darstellung durch farbige Rechtecke, die nach abfallender Lautstärke kleiner werdend übereinander montiert sind, wählten eine alternative Darstellung, in der jedes c durch den gleichen grünen Farbton dargestellt wird, wobei höhere Oktaven in leuchtenderem grün erscheinen. Bei komplizierten Sounds war es erforderlich, nur die wichtigsten, also die lautesten Töne herauszufiltern.
„Den Bau des Mikrofons, seine Untersuchungen und die Programmierung haben die beiden Jungforscherinnen weitgehend eigenständig durchgeführt“, begeistert sich Eckart Forster, der Leiter des Wahlunterrichts „Jugend forscht“ am ASG, der die beiden in die gute messtechnische Ausstattung des ASG einwies und sie beriet. „Grundlage für diese fundierten Forschungsarbeiten waren die gründliche Arbeitsweise, ein enormer Zeiteinsatz und ein hervorragendes Verständnis der wissenschaftlichen Hintergründe. Davon werden Julia und Katharina im Studium sehr profitieren.“
„Im Wahlunterricht Jugend forscht greifen wir die naturwissenschaftlichen Interessen von besonders interessierten Schülerinnen und Schülern auf und unterstützen sie dabei, diese Neigungen zu einem Erfolg zu führen, der sie in ihrer Entwicklung stärkt“, stellt Alfred Lippl fest.
Aufgrund ihres Sieges treten Julia und Katharina Anfang April mit ihrer Forschungsarbeit für das ASG beim Landeswettbewerb Bayern in Klingenberg an.